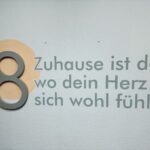Die Zahlen der beim vdw Sachsen organisierten Mitgliedsunternehmen für das Jahr 2023 zeigen einen dramatischen Einbruch bei den Investitionen und einen weiterhin hohen Leerstand. Die Statistik im Detail kann unter folgendem LINK HERUNTERGELADEN werden
Spannender Austausch 18. Juni mit Dr. Anita Maaß, Landesvorsitzende der sächsischen FDP und gleichzeitig Bürgermeisterin von Lommatzsch. An der Kleinstadt, die Terence Hill als Ehrenbürger hat, lassen sich die Herausforderungen aber auch Möglichkeiten in Regionen abseits der Metropolen sehr deutlich zeigen. Alles steht und fällt mit Menschen die sich engagieren und trotzdem die richtige Unterstützung benötigen. Vielen Dank für den detaillierten Einblick und das intensive und informative Gespräch!
Unser Verband wächst und erhält mit der Bosch Thermotechnik GmbH / Bosch Home Comfort Group einen weiteren starken Partner, insbesondere auch im Bereich der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wärmewende. Die Fördermitgliedschaft startet zum 1. Juli. Wir freuen uns sehr über den kommenden Austausch mit großem Mehrwert für unsere Mitgliedsunternehmen.
Die Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen der SPD-Bundestagsfraktion war am 31. Mai bei unserem Mitgliedsunternehmen, der kommunalen Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zu Gast. Geschäftsführerin Katrin Hentschel erklärte Elisabeth Kaiser – Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – Franziska Mascheck – stellvertretende bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion – Heike Heubach – Mitglied der AG Wohnen und Bauen der Fraktion – Bernhard Daldrup – bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion und Brian Nickholz – stellvertretender bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion – anhand des sanierten Mehrgenerationenhauses PH9 die Probleme und Herausforderungen der sozialen Wohnungswirtschaft in Sachsen am praktischen Beispiel. Im anschließenden Gespräch wurden diese Themen vertieft. Für Sachsen und unsere Unternehmen im Verband sind das insbesondere Bestandspflege, Umsetzung von energetischen Vorgaben und deren Bezahlbarkeit aber auch die Belastungen durch Altschulden und unnötige Bürokratie. Wir bedanken uns für den offenen und konstruktiven Austausch und nehmen das Angebot, im engen und direkten Dialog zu bleiben, gerne an.
Traditionell fand am 28. Mai im elements DELI auf dem Gelände der Zeitenströmung Dresden gemeinsam mit dem VSWG der Parlamentarische Abend der sozialen Wohnungswirtschaft Sachsens statt. In entspannter Atmosphäre wurden zwischen Wohnungswirtschaft, der Politik und der Wohnungswirtschaft verbundenen Institutionen auf Argumente und Positionen ausgetauscht. Wir danken dem sächsischen Staatsminister Thomas Schmidt für seine Grußworte und allen Gästen für ihr Kommen und die konstruktiven Gespräche.
Am Samstag, 20. April, besuchte Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, auf Einladung der SPD Dresden und ihres Landtagsabgeordneten und wohnungspolitischen Sprechers ,Albrecht Pallas, Dresden. Teil des Programms war ein Vorort-Termin im Jägerpark, wo unser kommunales Mitgliedsunternehmen, die WiD, zurückgekaufte Wohnungsbestände übernommen hat und wo auch wir unsere Positionen darlegen konnten. Im Anschluss gab es zu den Herausforderungen in diesem Zusammenhang speziell, aber auch zu denen Dresdens, Sachsens und Ostdeutschlands generell, einen sehr offenen Austausch im nahen AWO Wohnheim für körperbehinderte Jugendliche und Kinder. Vielen Dank für diese Plattform und das konstruktive Gespräch.
Fotos: Ralf Daniel und André Wellhäußer
Unser Fachausschuss Stadtentwicklung durfte bei seiner Sitzung am 15. April in unserer Geschäftsstelle wieder auf externe Kompetenz zurückgreifen, diesmal waren es Vertreterinnen und Vertreter vom Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung, Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft und Sächsische Aufbaubank – Förderbank – . Das behandelte Themenspektrum reichte dann auch von der Förderpolitik bis hin zur kommunalen Wärmeplanung. Es war ein sehr intensiver und konstruktiver Austausch mit großem Mehrwehrt für alle. Er ist eine vertrauensvolle Basis für die wir sehr dankbar sind und auf die wir weiter setzen.
Erstmalig haben sich am 9. April in Leipzig die ostdeutschen sozial organisierten Wohnungsverbände – Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG), vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vdw Sachsen), BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU), Verband norddeutscher Wohnungs- unternehmen e.V. (vnw), Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. (VdW Sachsen- Anhalt), Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt e.V. (vdwg Sachsen-Anhalt), Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw) – mit einer Stimme gemeinsam an die Öffentlichkeit, um auf die besondere Situation Ostdeutschlands einzugehen, die nicht mit anderen Bundesländern oder angespannten Wohnungsmärkten wie in München oder Hamburg gleichgesetzt werden kann. Ihr Appell richtet sich an die Bundesregierung, die Realität in Ostdeutschland nicht zu verfehlen und in einer Zeit multipler Krisen die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen sowie Maßnahmen im Auge zu behalten.
Ausgangslage in Ostdeutschland
In Ostdeutschland zählen zu den sieben Wohnungsverbänden insgesamt 1.052 Wohnungsunter- nehmen, die über einen Wohnungsbestand von 1,75 Millionen Wohneinheiten verfügen und damit dem Gros der ostdeutschen Bevölkerung ein Zuhause bieten. Davon stehen rund 143.000 Wohnungen leer, was einer Leerstandsquote von 8,23 Prozent entspricht. Die durchschnittliche Nettokaltmiete über die fünf ostdeutschen Bundesländer beträgt 5,40 Euro/m2. Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt rund 2.500 Wohnungen gebaut, aber rund 3.100 Wohnungen durch Rückbau vom Markt genommen. Die getätigten Investitionen liegen bei 3,38 Milliarden Euro.
„Die sozialen Vermieter sind ein wesentlicher und unverzichtbarer Faktor auf dem ostdeutschen Wohnungsmarkt“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunter- nehmen (vnw). „Sie sorgen mit ihren niedrigen Mieten für den sozialen Frieden in den Quartieren. Ihre hohen Investitionen machen sie vor allem in schwach entwickelten Regionen zu einem wichtigen wirtschaftlichen Anker. Für die dortige mittelständische Wirtschaft sind unsere Wohnungsunternehmen in vielen Fällen der Garant für das Überleben.“ Zugleich litten die Unternehmen in besonderem Maße unter den hohen Bau- und Zinskosten sowie den steigenden Anforderungen im Rahmen der Energiewende, so VNW-Direktor Andreas Breitner weiter. „Als soziale Vermieter haben wir stets die finanziellen Möglichkeiten unserer Mieter im Blick. Höhere Kosten infolge von Klimaschutzauflagen können und wollen unsere Mitgliedsunternehmen nicht auf ihre Mieterschaft abwälzen.“
Aktuell seien viele am Gemeinwohl orientierte Wohnungsunternehmen mit den sogenannten DDR- Altschulden belastet. „Besonders groß sind derzeit die Sorgen unserer Mieter vor steigenden Kosten für Fernwärme. Deren Anbieter lassen sich bei der Preisermittlung nicht in die Karten schauen. Wir fordern deshalb eine unabhängige Kartellbehörde, die Fernwärmeanbieter regelmäßig streng kontrolliert. Zudem sollten Anbieter von Fernwärme der Gemeinwohlorientierung unterworfen sein“, fordert VNW-Direktor Andreas Breitner.
Kaltmiete verwalten ja, gestalten nein
Die Frage nach der Bezahlbarkeit des Wohnens steht in Zeiten explodierender Energiekosten, der Baukostensteigerungen, der Inflation und Zinsentwicklung an oberster Stelle. Doch die ostdeutschen Wohnungsverbände können dies so nur halten, wenn auch die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Das Politiker-Mantra Neubau um jeden Preis gefährdet den Erhalt des bezahlbaren Wohnens in Ostdeutschland, wenn kein Geld mehr für Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes bleibt. „Wir verwalten perspektivisch dann nur noch verzweifelt den Erhalt unserer Häuser, statt wie bisher zu investieren und zu gestalten. Vor allem auch in Hinblick auf die zweite Sanierungswelle der Bestände, die der ostdeutschen Wohnungswirtschaft nach 1990 nun wieder bevorsteht. Auch geplante Mietrechtsverschärfungen sind hier kontraproduktiv“, mahnt VSWG-Vorstand Mirjam Philipp.
Pulverfass Betriebskosten
Die Bezahlbarkeit des Wohnens beinhaltet auch die enorme Verteuerung der Nebenkosten mit großen regionalen Unterschieden und hohen Bandbreiten. Obwohl in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema Heizenergie an Bedeutung verloren hat, steigen die Fernwärmepreise in 2024 in vielen Regionen. Laut der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. sind bei den Fernwärmenetzen teilweise bis zu 400 Euro mehr pro Haushalt fällig. Gründe dafür sind der Wegfall der Deckelung der Energiepreise ab April 2024 sowie der Wegfall der reduzierten Mehrwertsteuer und die Erhöhung des Arbeitspreises im Zuge des Gaspreisanstieges. Hinzu kommt noch die tendenziell weiter ansteigende CO2-Abgabe, deren Kosten anteilig auf Mieter und Vermieter verteilt werden. „Die Belastungsgrenze der Haushalte aus Miete und Betriebskosten ist schon jetzt erreicht und kann aufgrund der unterdurchschnittlichen Einkommen und Renten in Ostdeutschland nicht beliebig erhöht werden“, erklärt Jens Zillmann, Verbandsdirektor des VdW Sachsen-Anhalt.
Was kostet Klimaneutralität bis 2045?
Eine enorme Herausforderung ist auch das Erreichen des Ziels eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2045, wie es der Klimapfad der Bundesregierung in Umsetzung internationaler Vereinbarungen und des Klimaschutzgesetzes vorgibt. Hierzu hat die Bundesregierung derzeit den Weg insbesondere über eine weitere Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude vorgesehen. Erst in zweiter Linie soll die Dekarbonisierung der Energieerzeugung angegangen werden. „Dieser Weg ist extrem teuer und zudem nur sehr begrenzt effizient. Eine Studie in unserem Auftrag hat ergeben, dass die CO2-Einsparungswirkung bei Investitionen in die Dekarbonisierung der Energieerzeugung fünfmal höher ist als bei Investitionen in die Gebäudesanierung“, erklärt BBU-Vorständin Maren Kern.
„Uns ist derzeit noch völlig schleierhaft, wie die nach den derzeit vorgesehenen Vorgaben notwendigen Investitionen in die Wohnungen finanziert werden sollen“, so Kern weiter. Angesichts sehr niedriger Mieten in weiten Teilen der neuen Länder sei die Refinanzierung der vorgegebenen Investitionen hierüber praktisch ausgeschlossen. Da die Umlagemöglichkeit zudem gesetzlich bei zwei bzw. drei Euro/m2 gekappt ist, wären viele gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen in ihrer Existenz bedroht: „Die Umsetzung der gesetzlich geforderten Investitionen würde mindestens zu einer Verdopplung ihrer Schulden und einer Vervielfachung des Schuldendienstes führen“, warnt Kern.
In der BBU-Studie wurde mit einem fiktiven, aber realistischen Investitionsbedarf von derzeit anfänglich rund 1.050 Euro/m2 Wohnfläche kalkuliert, der bis 2045 auf rund 2.000 Euro ansteigt. Zur soliden Refinanzierung dieser Investitionen wäre rechnerisch eine Nettokaltmiete bereits anfänglich von über elf Euro notwendig, die dann weiter ansteigen würde. „Gegenüber der aktuellen Durchschnittsmiete in den neuen Ländern wäre das mehr als eine Verdopplung“, rechnet Kern vor. Selbst unter Anrechnung einer möglichen Förderung kämen auf die Mieter in diesem Beispiel eine um drei Euro pro Monat und Quadratmeter höhere Miete zu.
Entwicklung des Leerstandes
Während sich in den Großstädten der ostdeutschen Bundesländer die Leerstandsquoten stabilisieren, zeichnet sich im ländlichen Raum ein sehr unterschiedliches Bild mit teils sehr hohen Leerstandsquoten ab. Ursache dafür ist die Bevölkerungsentwicklung durch den demografischen Wandel und die Altersstruktur in Ostdeutschland, die ab 1990 einen Geburtenknick aufweist. Durch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge konnte der Leerstand etwas abgefedert werden. Nach den Prognoserechnungen des Statistischen Bundesamtes wird die Bevölkerung in Ostdeutschland bis 2035 weiter schrumpfen. Insbesondere in den strukturschwachen Regionen des ländlichen Raums wird dies zu einem weiteren Anstieg der Leerstände führen. „Eine alarmierende Entwicklung, die das Bestreben der Bundesregierung, den Fokus auf den Neubau zu richten, konterkariert. Vielmehr muss unter Berücksichtigung der Bedarfe der ostdeutschen Wohnungswirtschaft nun der Bestand vermehrt im förderinhaltlichen Mittelpunkt stehen. Denn: Es gibt hier keine angespannten Wohnungsmärkte, sondern mehr und mehr angespannte wirtschaftliche Rahmenbedingungen“, so Dr. Matthias Kuplich, Verbandsdirektor des vdwg Sachsen-Anhalt.
Fachkräftemangel als Chance sehen
Die ostdeutsche Wohnungswirtschaft verfügt über ein großes Potenzial an Wohnungen aller Größen und Ausstattungen. Über die Neuansiedlung von großen Tech-Unternehmen wird der Bedarf an Wohnraum exorbitant anwachsen und möglicherweise dort so die Leerstandsproblematik absenken.
„Wo Arbeitsplätze entstehen, werden Fachkräfte und Wohnungen gebraucht. Facharbeiterlöhne erfordern bezahlbaren Wohnraum und das bezahlbare Wohnen braucht eine gemeinsame Anstrengung und ausreichende Förderung“, bringt es Frank Emrich, Verbandsdirektor des vtw Thüringen, auf den Punkt. Für einen passenden Aufbau der Infrastruktur bedarf es vertraglich gebundene Planungssicherheit für die Wohnungsunternehmen und vor allem auch für den Aufbau von Mobilitätskonzepten, um die Arbeitnehmer zu ihren Tätigkeitsorten zu bringen. Konzepte wie Shuttlebusse bzw. der Ausbau der Mobilitätsinfrastruktur sind unerlässlich und bedürfen der Unterstützung auf Bundesebene.
Nach wie vor Altschulden
Auch 34 Jahre nach der Wiedervereinigung stellen die Alt- und Wendeschulden bei getilgten Beträgen eine Belastung der ostdeutschen Wohnungsunternehmen ohne tatsächliche Investitionen in die Gebäude dar. Laut einer aktuellen Umfrage des vdw Sachsen unter seinen Mitgliedern, die exemplarisch für alle Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland gewertet werden kann, sind für über 80 Prozent der Unternehmen diese Art der unverschuldeten Schulden nach wie vor ein Hemmnis. Selbst wenn mittlerweile etwa drei Viertel dieser willkürlichen Verbindlichkeiten beglichen wurden, stehen noch immer Milliardenbeträge aus und offen. „Dadurch gebundene bzw. wegen der bereits erfolgten Tilgung fehlende Mittel sind ein enormes Hindernis für erforderliche und geforderte Maßnahmen, nicht zuletzt etwa im Rahmen der Gebäude-Energiewende“, führt Alexander Müller, Verbandsdirektor des vdw Sachsen, aus. Eine Entlastung noch bestehender und bereits getilgter Altschulden als Investitionszuschuss schafft die derzeit nicht vorhandenen finanziellen Räume für die dringend benötigten Investitionen, insbesondere im ländlichen Raum.
Mit Dr. Albrecht Buttolo hatten wir am 8. April den ehemaligen sächsischen Staatsminister des Innern bei uns zu Besuch. Anlass ist die 50-jährigen Historie des Wohngebiets Fritz Heckert in Chemnitz. Das war aber nicht das einzige Thema des sehr angenehmen Gesprächs. Sein Engagement und seine Verdienste für die sächsische Wohnungswirtschaft werden nach wir vor sehr hoch geschätzt. Wir wünschen Albrecht Buttolo alles Gute und viel Gesundheit und freuen uns bei Gelegenheit auf eine Fortsetzung. Er bleibt uns ein gern gesehener und immer willkommener Gast.
Die Wohnungsunternehmen bei uns in den ostdeutschen Bundesländern haben gerade in ländlichen Gegenden häufig mit hohem Leerstand zu kämpfen. Zum Thema Aktivierung von Leerstand haben wir uns am 27. März im BMWSB mit Bundesbauministerin Klara Geywitz getroffen und ausgetauscht. Die Initiative geht zurück auf das Bündnis bezahlbarer Wohnraum. Gut, dass auch die speziellen Belange und Herausforderungen der ostdeutschen Wohnungswirtschaft auf Bundesebene verstärkt Gehör und Beachtung finden. Wir setzen auf die versprochene Etablierung und zeitnahe Fortsetzung dieses Gesprächsformats.
Fotos: André Wagenzik
Im Norden Dresdens wird ein Großteil der Halbleiter-Chips innerhalb der EU produziert. Nach Prognosen kommen durch Neuansiedlungen bis 2030 20.000 neue Arbeitsplätze hinzu. Dazu gehen 7.000 Beschäftigte in den Ruhestand und müssen ersetzt werden. Macht 27.000 Haushalte mit entsprechenden Partnern und Kindern.
“Und wo sollen die alle wohnen?”
Auf Einladung von Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden, fand am 25. März eine erste Konferenz zur Wohnentwicklung im Dresdner Norden statt. Ziel soll sein, die maßgeblichen Akteure zu vernetzen, um gemeinsam passende Lösungen zu finden. Der vdw Sachsen steht mit seinen Mitgliedsunternehmen als Partner bereit.
Foto: Nico Pockel / Stadtverwaltung Dresden
Arbeitstreffen am 22. März in unserer Geschäftsstelle mit Albrecht Pallas, dem wohnungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Im Fokus standen demzufolge vor allem Landesspezifika bei der Sanierung, dem Bauen, dem Wohnen, den Mieten, den Vorgaben im Energie- und Klimabereich und den wachsenden Herausforderungen sowohl auf dem Land wie in den Metropolen. Unsere Positionen dazu sind in einem Papier zusammengefasst, das gemeinsam mit dem Partnerverband VSWG erstellt wurde und das demnächst auch als gedruckte Broschüre zur Verfügung stehen wird. Danke für das konstruktive Gespräch, das eine gute Basis für den weiteren Austausch ist.