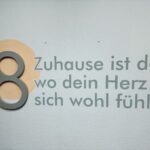Intensiver fachlicher Austausch am 30. August in unserer Geschäftsstelle mit Lars Rohwer. Der Dresdner sitzt für die CDU im Bundestag und ist dort Mitglied des Ausschusses Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Und genau um diese Themen ging es auch, ganz konkret um einfach(er)es Bauen aber auch Sanieren im Bestand, um Ansätze gegen den Leerstand außerhalb der Metropolen, um Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Halbleiterindustrie in Dresden, um (Über)Regulierungen und nicht zuletzt um die noch immer noch nicht gelöste Altschuldenproblematik. Vielen Dank für das konstruktive und lösungsorientierte Gespräch!
Die neue Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden (FRL-RüWo) wurde am 20. Juni 2024 im Sächsischen Amtsblatt veröffentlicht und ist am 21. Juni 2024 in Kraft getreten. Sie fördert den Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohngebäuden, einschließlich Gewerbeflächen in überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden. Nicht förderfähig sind weiterhin der Teilrückbau, der Rückbau von Gebäuden in geschlossener, straßenparalleler Blockrandbebauung sowie unbewohnbare, ruinöse Wohngebäude.
Die Zuschüsse wurden auf 90 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben erhöht, maximal jedoch 100 Euro je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche. Zuwendungsempfänger sind weiterhin die Gemeinden, die die Zuwendungen an Dritte weiterleiten können. Sofern erforderlich, sind eine baurechtliche Abbruchgenehmigung und eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung als Zuwendungsvoraussetzungen nachzuweisen. Der Nachweis der Erfüllung aller Zuwendungsvoraussetzungen erfolgt durch Eigenerklärung im Antragsformular.
Die Antrags- und Bewilligungsstelle bleibt die Sächsische Aufbaubank (SAB). Für die Antragstellung sind die auf der Internetseite der SAB abrufbaren Formulare zu verwenden. Die SAB schafft derzeit die Voraussetzungen dafür, dass das Antrags- und Bewilligungsverfahren den Städten und Gemeinden voraussichtlich ab dem 8. August 2024 vollständig digital zur Verfügung steht.
Für das Kalenderjahr 2024 stehen Haushaltsmittel in Höhe von 3 Millionen Euro zur Verfügung.
Weitere Informationen sowie den vollständigen Text der Förderrichtlinie entnehmen Sie bitte unserem Rundschreiben vom 21. Juni 2024.
Unser Verband wächst und erhält mit der Bosch Thermotechnik GmbH / Bosch Home Comfort Group einen weiteren starken Partner, insbesondere auch im Bereich der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wärmewende. Die Fördermitgliedschaft startet zum 1. Juli. Wir freuen uns sehr über den kommenden Austausch mit großem Mehrwert für unsere Mitgliedsunternehmen.
Die Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen der SPD-Bundestagsfraktion war am 31. Mai bei unserem Mitgliedsunternehmen, der kommunalen Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zu Gast. Geschäftsführerin Katrin Hentschel erklärte Elisabeth Kaiser – Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – Franziska Mascheck – stellvertretende bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion – Heike Heubach – Mitglied der AG Wohnen und Bauen der Fraktion – Bernhard Daldrup – bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion und Brian Nickholz – stellvertretender bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion – anhand des sanierten Mehrgenerationenhauses PH9 die Probleme und Herausforderungen der sozialen Wohnungswirtschaft in Sachsen am praktischen Beispiel. Im anschließenden Gespräch wurden diese Themen vertieft. Für Sachsen und unsere Unternehmen im Verband sind das insbesondere Bestandspflege, Umsetzung von energetischen Vorgaben und deren Bezahlbarkeit aber auch die Belastungen durch Altschulden und unnötige Bürokratie. Wir bedanken uns für den offenen und konstruktiven Austausch und nehmen das Angebot, im engen und direkten Dialog zu bleiben, gerne an.
Arbeitstreffen am 22. März in unserer Geschäftsstelle mit Albrecht Pallas, dem wohnungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Im Fokus standen demzufolge vor allem Landesspezifika bei der Sanierung, dem Bauen, dem Wohnen, den Mieten, den Vorgaben im Energie- und Klimabereich und den wachsenden Herausforderungen sowohl auf dem Land wie in den Metropolen. Unsere Positionen dazu sind in einem Papier zusammengefasst, das gemeinsam mit dem Partnerverband VSWG erstellt wurde und das demnächst auch als gedruckte Broschüre zur Verfügung stehen wird. Danke für das konstruktive Gespräch, das eine gute Basis für den weiteren Austausch ist.
In dieser Veranstaltung der SAENA wird auf die aktuellen Möglichkeiten und die technische Umsetzung von Photovoltaikanlagen in Mehrfamilienhäusern eingegangen, unter anderem auch Balkonsolar sowie auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten. Diese Online-Veranstaltung richtet sich an alle Wohnungsunternehmen und -Wohnungsgenossenschaften, WEG-Verwalter und interessierte Eigentümer.
Vorläufige Inhalte:
- Photovoltaik für Mehrfamilienhäuser unter den aktuellen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
- Balkonsolaranlagen aus Vermieterperspektive
- Möglichkeiten zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung
- am Ende des Vortrages besteht die Möglichkeit zur Diskussion von Fragen aus dem Chat
Weitere Infomrationen zur Veranstaltung der SAENA Sächsische Energieagentur finden Sie hier.
Mit der Green Fusion GmbH steht unserem Verband und seinen Mitgliedern ein weiterer innovativer Partner zur Seite. Green Fusion ist der Energiespar-Pilot für alle Heizungskeller. Das Unternehmen beschreibt sein Leitbild:
Wir digitalisieren, automatisieren und optimieren Heizungskeller. Warum? Wir denken, dass jeder Mensch eine wohlig warme Wohnung haben sollte. Aber: die Energiesysteme der Immobilienwirtschaft verursachen fast ein Fünftel unserer Emissionen! Dieses Spannungsfeld treibt uns an, wir glauben an eine nachhaltige Transformation der Wohnungswirtschaft und dafür arbeiten wir jeden Tag mit vollem Einsatz. Unsere intelligente Heizungssteuerung optimiert den Betrieb der Millionen Bestandsanlagen in den Heizungskellern, egal ob Gas, Öl oder Fernwärme. Die Installation ist einfach, unkompliziert und minimalinvasiv. Gleichzeitig regelt unsere Lösung auch das komplexe Zusammenspiel multivalenter Energiesysteme und ist somit die Basis für die Kopplung der Sektoren Wärme, Strom und E-Mobilität. Für eine holistische Optimierung des “Gesamtsystem Haus” und eine nachhaltige Zukunft der Wohnungswirtschaft.
Die Mitgliedschaft wurde auf den BBU-Tagen in Bad Saarow am 19. März 2024 besiegelt. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und den Austausch.
Das Europäische Parlament hat am Dienstag, den 12. März 2024, die bereits mit dem Rat vereinbarten Pläne zur Senkung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen von Gebäuden angenommen. Mit 370 zu 199 Stimmen bei 46 Enthaltungen hat das EU-Parlament die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie beschlossen. Die “Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden” befindet sich seit Dezember 2021 im EU-Gesetzgebungsverfahren. Im Wesentlichen entspricht die nunmehr verabschiedete Fassung der Einigung im Trilogverfahren vom Dezember 2023.
Mit der vorgeschlagenen Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden soll erreicht werden, dass der Gebäudesektor in der EU zum einen bis 2030 deutlich weniger Treibhausgasemissionen erzeugt und Energie verbraucht und zum anderen bis 2050 klimaneutral wird. Außerdem sollen mehr Gebäude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz renoviert werden.
Neubauten sollen laut dem Beschluss ab 2030 emissionsfrei sein. Für Neubauten, die von Behörden genutzt werden oder ihnen gehören, soll dies bereits ab 2028 gelten. Bei Wohngebäuden müssen die Mitgliedstaaten durch geeignete Maßnahmen den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch bis 2030 um mindestens 16 Prozent und bis 2035 um mindestens 20 bis 22 Prozent senken. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass mindestens 55 Prozent der Senkung des durchschnittlichen Primärenergieverbrauchs durch die Renovierung der 43 Prozent der Wohngebäude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz, der sogenannten “Worst Performing Buildings “, erreicht werden. Darüber hinaus verpflichtet die neue Richtlinie die Mitgliedstaaten, bis 2030 16 % und bis 2033 26 % der Nichtwohngebäude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz zu renovieren und sicherzustellen, dass sie die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz erfüllen.
Sofern technisch und wirtschaftlich machbar, müssen die Mitgliedstaaten ferner bis 2030 schrittweise Solaranlagen in öffentlichen Gebäuden und Nichtwohngebäuden je nach Größe und in allen neuen Wohngebäuden installieren.
Nebstdem müssen die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Dekarbonisierung von Heizungsanlagen und zum schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe zur Wärme- und Kälteversorgung ergreifen: Bis 2040 soll es keine mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkessel mehr geben. Ab 2025 dürfen keine fossilen Heizkessel mehr gefördert werden. Finanzielle Anreize für hybride Heizsysteme, bei denen beispielsweise Heizkessel mit Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen kombiniert werden, sind dagegen weiterhin zulässig.
Ausnahmen von den neuen Vorschriften sind für landwirtschaftliche Gebäude und Baudenkmäler möglich, und die EU-Mitgliedstaaten können beschließen, auch Gebäude, die wegen ihres besonderen architektonischen oder historischen Werts geschützt sind, sowie provisorische Gebäude, Kirchen und Gebäude, die für Gottesdienste genutzt werden, auszunehmen.
Nach dem Beschluss des Europäischen Parlaments muss nun noch der Rat förmlich billigen. Erst dann stehen die konkreten Formulierungen fest und die grundsätzlich zweijährige Frist zur Umsetzung in nationales Recht beginnt.
In Magdeburg fand am 27. und 28. Februar die Klausurtagung der Konferenz der Verbandsdirektoren statt. Ganz oben auf der Agenda stand ein Gutachten zum Thema “Bezahlbar Wohnen und nachhaltig Bauen”. Es wird immer schwieriger, in diesem Zusammenhang das “und” im Titel zu halten und nicht durch ein “oder” ersetzen zu müssen. Eine Erkenntnis der Tagung ist daher, die Gründe dafür noch konkreter mit Zahlen und Praxisbeispielen belegt an die Verantwortlichen zu übermitteln, sowohl beim Bund als auch in den Ländern.
Das Bundesbauministerium und die KfW Förderbank teilen mit, dass ab dem 20. Februar die Antragsverfahren für die im Dezember 2023 eingestellten KfW-Förderprogramme Klimafreundlicher Neubau (KFN), Genossenschaftliches Wohnen und Altersgerecht Umbauen wieder geöffnet werden.
Trotz dieser erfreulichen Nachricht bleibt ein bedeutendes Defizit bestehen: Die unzureichende Heizungsförderung. Während Privatpersonen bereits ab dem 27. Februar Förderanträge stellen können, müssen Wohnungsunternehmen voraussichtlich bis August 2024 auf die Öffnung der Antragsverfahren für die Bundesförderung für effiziente Gebäude Heizungsförderung – sowohl für Wohngebäude und Nichtwohngebäude als auch für den BEG Ergänzungskredit für Einzelmaßnahmen in Nichtwohngebäuden – warten.
Förderanträge für Investitionszuschüsse von Heiztechnik, d.h. Solarthermieanlagen, Biomasseheizungen, elektrisch betriebene Wärmepumpen, Brennstoffzellenheizungen, wasserstoffbetriebene Heizungen, innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien, der Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz und provisorische Heiztechnik bei Heizungsdefekt, können jedoch nach Ziffer 9. 2.1 der BEG EM-Richtlinie bis zum 30. November 2024 nachgeholt werden, sofern der Vorhabenbeginn zwischen dem Datum der Veröffentlichung der Förderrichtlinie im BAnz (veröffentlicht am Freitag, 29. Dezember 2023) und dem 31. August 2024 liegt.
Im wahrsten Sinne des Wortes großes Finale unserer regionalen Erfahrungsaustausche heute im winterlichen Thalheim im Erzgebirge. Traditionell haben wir im Regierungsbezirk Chemnitz die höchste Teilnehmerzahl. Das war auch heute so und Resultat waren intensive Gespräche und eine lebhafte Debatte über die Themen, welche die sächsische Wohnungswirtschaft derzeit bewegen. Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann gab eindrucksvoll wieder, warum und wie sehr es sich lohnt, sich gemeinsam mit seinem kommunalen Wohnungsunternehmen für die Gemeinde und ihre Bürger einzusetzen. Ulla Stecher, Geschäftsführerin der ansässigen Wohnungsbaugesellschaft “Zwönitztal” zeigte das dann auch gleich konkret an einem mit Hilfe eines sächsischen Förderprogramms fast fertiggestellten Sanierungsvorhabens. Es handelt sich um einen grundhaften Umbau eines Hochhauses zum Service-Wohnen. Sehr bald stehen hier insgesamt 105 Wohneinheiten und Gewerbeeinheiten zur Verfügung.
Klares Fazit der vergangenen drei Tage: Die Unternehmen des vdw Sachsen sind engagiert wie eh und je und wenn wir die allerdings dringend nötige Unterstützung bekommen, kann das auch in Zukunft so bleiben. Herzlichen Dank allen Teilnehmern, Gastgebern, den Beteiligten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verbandes!
Mit Franziska Mascheck, der SPD-Bundestagsabgeordneten für den Landkreis Leipzig, gab es am 7. Februar in ihrem Büro in Markkleeberg einen sehr produktiven Austausch. Franziska Mascheck ist auch Mitglied und stellvertretende Sprecherin ihrer Fraktion im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen im Bundestag und somit eine sehr wichtige Gesprächspartnerin für uns. Die Themen waren dann auch vielfältig. Dazu gehörten natürlich die aktuelle Förderpolitik aber auch die notwendige Stärkung des ländlichen Raums und die besonderen Bedingungen der Wohnungswirtschaft und damit der Menschen in Sachsen. Vielen Dank für diesen offenen und direkten Dialog an dem wir festhalten werden.