Archiv
Pressemitteilungen
VSWG und vdw Sachsen spenden gemeinsam 4.000 Euro an DESWOS und setzen Zeichen der Solidarität zur Weihnachtszeit
Gerade in der Vorweihnachtszeit rücken Themen wie Solidarität und soziale Verantwortung besonders in den Fokus. Auch in diesem Jahr unterstützen die beiden Verbände der sächsischen Wohnungswirtschaft – der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) und der vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. (vdw Sachsen) – die DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e. V. mit jeweils 2.000 Euro. Dies ist ein zusätzlicher Beitrag und zugleich ein wichtiges Signal zu dem, was viele der Mitgliedsunternehmen beider Verbände mit ihrem regelmäßigen Beitrag selbstverständlich bereits seit vielen Jahren leisten. Mit der gemeinsamen Spende von insgesamt 4.000 Euro möchten die Verbände der sozial orientierten Wohnungswirtschaft notleidenden Familien in Asien, Afrika und Lateinamerika die Chance auf ein sicheres Zuhause und eine bessere Zukunft geben.
„Wir möchten den Menschen in Not ein Zuhause geben und mit unserer Spende ein Zeichen der Hoffnung setzen. Die Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort ist heute aktueller denn je“, erklären Mirjam Philipp, Vorstand vom VSWG sowie Alexander Müller, Verbandsdirektor des vdw Sachsen.
Die DESWOS engagiert sich seit über fünf Jahrzehnten weltweit für menschenwürdige Wohn- und Lebensbedingungen. Mit Projekten zum Bau von Wohnraum, zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Förderung nachhaltiger Lebensperspektiven leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung und zur Sicherung von Lebensqualität. Zahlreiche sächsische Wohnungsgenossen-schaften und Wohnungsgesellschaften unterstützen die DESWOS seit vielen Jahren – selbstverständlich und unaufgeregt durch ihre Mitgliedschaft. Ihnen gilt an dieser Stelle ein ausdrückliches Dankeschön.
„Gerade in Zeiten globaler Krisen und wachsender Unsicherheiten ist Solidarität über Grenzen hinweg unverändert wichtig. Mit unserer Unterstützung wollen wir Verantwortung übernehmen und zeigen, dass auch kleine Beiträge Großes bewirken können“, betonen die beiden Verbände.
Wenn auch Sie den Menschen in Not zu einer menschenwürdigen Unterkunft verhelfen möchten, spenden Sie bitte. Es zählt jeder Euro. Bitte geben Sie bei einer Spende über 200 Euro auch Ihre Anschrift an, damit DESWOS Ihnen im Nachgang eine Spendenbescheinigung übermitteln kann.
DESWOS e.V.
Spendenkonto IBAN DE87 3705 0198 0006 6022 21
Sparkasse KölnBonn SWIFT-BIC COLSDE33
Spendenstichwort: DEWOS Projekthilfe
vdw Aktuell 2/2025
vdw Aktuell 2/2025
Wohnraum sichern, Regionen stärken: Mitteldeutschlands Chance liegt in den Quartieren
Pressemitteilung
der mitteldeutschen Wohnungs- und Immobilienverbände:
BFW, VSWG, vdw Sachsen, vtw,
VdWg Sachsen-Anhalt, VdW Sachsen-Anhalt
am 01.12.2025
Wohnraum sichern, Regionen stärken: Mitteldeutschlands Chance liegt in den Quartieren.
Verbände aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern tragfähige Lösungen für Klimaschutz, Infrastruktur und demografischen Wandel in den Quartieren.
Während bundesweit über Wohnungsmangel in Metropolen diskutiert wird, kämpft die mitteldeutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit anderen Realitäten – und zu gleich mit denselben politischen Maßnahmen. Die Verbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern ein Umdenken: Neben dem notwendigen Wohnungsneubau in Ballungsräumen sind gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land der Schlüssel zu einem stabilen Wohnungsmarkt!
Die Bestandswohnungen in den mitteldeutschen Bundesländern sind bezahlbar, aber zu nehmend unter Druck: Die Kosten für energetische Sanierung und Barrierefreiheit steigen, während die Mieten niedrig bleiben. Ohne differenzierte Förderung droht das, was einmal sozialer Fortschritt war, zur wirtschaftlichen Hypothek zu werden.
Klimaschutz darf nicht an der Miete scheitern
Die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft steht zu den Klimazielen – aber sie braucht machbare Wege dorthin. Klimaschutz darf nicht zur sozialen Frage werden. Die Unternehmen
investieren, wo sie können. Doch mit Mieten zwischen fünf und sechs Euro pro Quadratmeter ist es unmöglich, die geforderten Sanierungsstandards allein zu stemmen. Den Paradigmenwechsel vom optimal gedämmten Einzelobjekt hin zum bestmöglichen finanziellen Ressourceneinsatz fordert die Branche schon lange. Es braucht Förderinstrumente, die Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz in Einklang bringen – differenziert nach regionalen Voraussetzungen und Mietniveaus.
Unsere Vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:
Mitteldeutsche Pressemitteilung
Wirtschaft der Region unterstützt Leipzig als Olympiastadt
“Wir sind bereit, gemeinsam den Olymp zu erklimmen”
vdw Aktuell 1/2025
vdw Aktuell 1/2025
Jahresstatistik 2024: „Nur so geht’s weiter!"
Streichung des Landesrückbauprogramms ist falsches Signal für die Wohnungswirtschaft
Dresden, 25. März 2025. Die sächsische Landesregierung hat im Rahmen der aktuellen Haushaltsverhandlungen das Landesrückbauprogramm gestrichen – und das, obwohl es erst im vergangenen Jahr aufgestockt wurde.
„Diese kurzfristige Entscheidung sendet ein fatales Signal“, betont VSWG-Vorstand Mirjam Philipp. „Statt verlässlicher und planbarer Rahmenbedingungen, die für die Wohnungswirtschaft unerlässlich sind, herrscht nun erneut Unsicherheit.“ Besonders im ländlichen Raum sei der Rückbau weiterhin dringend notwendig.
Auch Alexander Müller, Verbandsdirektor des vdw Sachsen, zeigt sich enttäuscht: „Unsere Mitgliedsunternehmen – Wohnungsgenossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften – haben bis 2030 einen Rückbaubedarf von bis zu 5.000 Wohnungen gemeldet.“
Dass das Rückbauprogramm im vergangenen Jahr nicht vollständig ausgeschöpft wurde, sei kein Zeichen mangelnden Interesses, so Müller weiter. Eine Kleine Anfrage im Sächsischen Landtag und die Antwort des zuständigen Staatsministeriums SMIL belegen das Gegenteil: Von den bereitgestellten 3 Millionen Euro wurden rund 1,75 Millionen Euro abgerufen, über 300 Wohnungen konnten damit zurückgebaut werden. Angesichts des späten Programmstarts Mitte 2024 sei dies eine bemerkenswert hohe Abrufquote. „Diese hätte noch deutlich besser ausfallen können, wenn – wie von unseren Verbänden wiederholt gefordert – auch Teilrückbaumaßnahmen förderfähig gewesen wären“, resümiert Müller.
„Wir setzen nun umso stärker darauf, dass die bestehenden Förderinstrumente im sozialen Wohnungsbau weitergeführt und verbessert werden“, fordern Philipp und Müller gemeinsam.
Insbesondere die Richtlinien preisgünstiger Mietwohnraum (pMW) für die Sanierung sowie gebundener Mietwohnraum (gMW) für den Neubau müssten so ausgestaltet sein, dass sie im Sanierungsbereich weiterhin praktikabel und beim Neubau wirtschaftlich tragfähig bleiben.
DOWNLOAD DER PRESSEMITTEILUNG ALS PDF
Gemeinsame Pressekonferenz der sächsischen Wohnungs- und Energiewirtschaft
Am 10. Februar fand beim vdw Sachsen eine gemeinsame Pressekonferenz der sächsischen Wohnungs- und Energiewirtschaft statt (VSWG, VKU Landesgruppe Sachsen und vdw Sachsen). Thema war die dringende Notwendigkeit entschlossenen Handelns für bezahlbares Wohnen, Strom und Wärme – auch nach der Bundestagswahl.
Die steigenden Wohn- und Energiekosten setzen sowohl Mieter als auch Wohnungsunternehmen unter enormen Druck. Um langfristig bezahlbaren Wohnraum zu sichern, fordern die Verbände klare Maßnahmen von der zukünftigen Bundesregierung. Dazu gehören:
Senkung der Kostenbelastung für Mieter und Wohnungsunternehmen
Abbau bürokratischer Hürden und gezielte Förderprogramme
Verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen in nachhaltiges Wohnen und Energie
Die Vertreter der Verbände warnten vor den fatalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, sollte kein entschlossenes Handeln erfolgen. Sie fordern eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Politik, um eine sozial gerechte und klimafreundliche Wohnungs- und Energiewirtschaft sicherzustellen.
Es wurden konkrete Lösungsansätze aufgezeigt und die Notwendigkeit einer fairen Lastenverteilung zwischen Staat, Wirtschaft und Mietern betont.
Die Verbände appellieren an die künftige Bundesregierung, diese Herausforderungen aktiv anzugehen und nachhaltige Lösungen umzusetzen.
Umfassende Sanierung des Wohnhauses Remscheider Straße 22-27: WGP setzt auf preisgünstigen Mietwohnraum und Bestandsentwicklung


Statement zur Leerstandsstrategie des Bundesbauministeriums
Bundesbauministerin Klara Geywitz hat am 21. Januar in Berlin die Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung vorgestellt. Dazu erklärt Alexander Müller, Verbandsdirektor des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft:
Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Bundesregierung sich der speziellen Situation und Herausforderungen ostdeutscher Wohnungsmärkte angenommen hat. Die skizzierten Punkte gehen aber nicht weit genug und leider zum Großteil am eigentlichen Problem vorbei. Leerstand in Sachsen ist kein hausgemachter Mangel, den man flächendeckend mit besserem Marketing, punktuellen Anreizen oder gar Umwidmung von leerstehenden Gewerbeflächen in dann leerstehenden Wohnraum beseitigen kann.
Regionen, in denen ein Viertel bis ein Drittel aller vermietbaren Wohnungen leer stehen sind in Sachsen keine Seltenheit. Diese Zahlen sind eine deutlich härtere Realität als die genannten harmloser klingenden „bis zu 20 Prozent“ im Papier des Bundesbauministeriums.
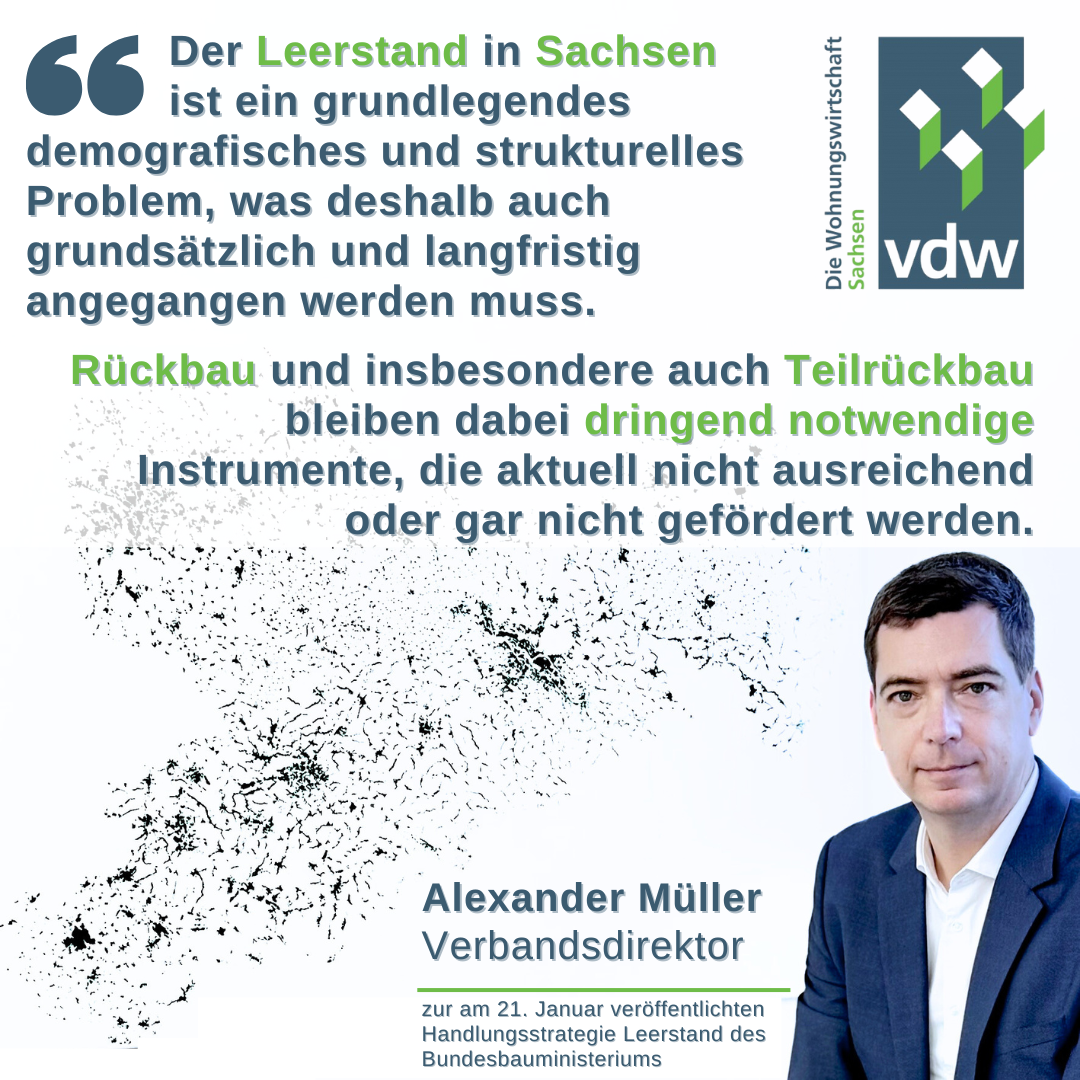
Der Leerstand in Sachsen und Ostdeutschland ist ein grundlegendes demografisches und strukturelles Problem, was deshalb auch grundsätzlich und langfristig angegangen werden muss. Rückbau und insbesondere auch Teilrückbau bleiben dabei dringend notwendige Instrumente, die aktuell nicht ausreichend oder gar nicht gefördert werden.
Beim Thema Altschulden weist unser Verband schon lange auf die damit verbundenen massiven Ungerechtigkeiten und langfristigen zusätzlichen Belastungen ostdeutscher Wohnungsunternehmen hin und hat konkrete Vorschläge für entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten
Mitteldeutsche Forderungen zur Bundestagswahl
Die mitteldeutschen Verbände der sozial orientierten Wohnungswirtschaft repräsentieren Unternehmen mit rund 1,2 Millionen Wohnungen. Wir sind Garanten für eine gute, sichere und
bezahlbare Wohnraumversorgung. Unsere Mieterinnen und Mieter stehen dabei stets im Mittelpunkt unseres Handelns. Damit wir auch künftig unseren unverzichtbaren Beitrag zur sozialen
Stabilität und einer nachhaltig ausgerichteten Wohnungswirtschaft leisten können, muss unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit erhalten bleiben. Unsere Forderungen dazu haben wir in diesem Dokument zusammengefasst welches die Positionen unseres Bundesverbands GdW (https://www.gdw.de/bundestagswahl-2025/) ergänzt und ihnen zur Seite steht.
vdw Aktuell 2/2024
vdw Aktuell 2/2024